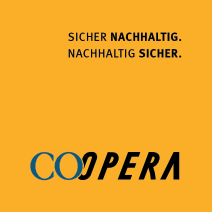News
CoOpera-Weiterbildung «Wirtschaft verstehen und gestalten»- jetzt anmelden
Bereits zum zweiten Mal startet die CoOpera Weiterbildung «Wirtschaft verstehen und gestalten». An fünf ganztägigen Workshops werden praxisrelevante, betriebs- und volkswirtschaftliche Themen vom CoOpera-Standpunkt bearbeitet.
«Die Wirtschaft als Ganzes trägt die Verantwortung für die Existenzgrundlage aller in ihr lebenden Menschen, und zwar gleichermassen der Arbeitsfähigen wie der noch nicht oder nicht mehr Arbeitsfähigen (Kinder, Arbeitslose, Behinderte, alte Menschen).» Es ist damit kein abstraktes Marktmodell gemeint, welches die wirtschaftliche Verantwortung übernimmt. Aus CoOpera-Sicht sind alle einzelnen in der Wirtschaft tätigen Menschen gemeint, welche Verantwortung übernehmen, weil das Marktmodell ökologisch und sozial völlig unzureichend ist. In den einzelnen Workshops stellen Fachreferenten aus dem CoOpera-Umfeld ihre eindrücklichen Ansätze für verantwortungsvolles, unternehmerisches Handeln kompetent vor und geben grossen Raum für Dialog und Fragen. Ergänzend können die Teilnehmenden direkt die Chancen von Eurythmie in Unternehmen für erfolgreiche Kommunikation im Betrieb erleben.
Kommentare der Teilnehmenden zum Kurs:
«Sehr tiefgründig und aktuell…»
«Besonders gut gefallen hat mir der Bezug zur Praxis…»
«Vielfältig nutzbare und aktuelle Themenschwerpunkte…».
«Ich werde den Kurs unbedingt weiterempfehlen, weil er einen lebendigen Einblick in assoziatives Wirtschaften gab, anregend war …»
CoOpera-Weiterbildung «Wirtschaft verstehen und gestalten»
Start am 10. August 2018, jeweils von 08.40-16.50 Uhr (Zeiten abgestimmt auf SBB-Fahrplan)
Ort: Kosthaus Lenzburg (gleich beim Bahnhof Lenzburg).
Kosten: CHF 1'800.- (inkl. alle Unterlagen)
Kontakt und Anmeldung: Franc B. Schwyter, Erlenweg 14, 5034 Suhr Tel. 079 359 22 14 E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
![]() Einladung Kurs verstehen und gestalten 2018
Einladung Kurs verstehen und gestalten 2018![]() Programm Kurs verstehen und gestalten 2018
Programm Kurs verstehen und gestalten 2018
Neues Mitglied im Stiftungsrat
Unsere neue Stiftungsrätin ist schon mehr als 10 Jahre bei der Stiftung Rüttihubelbad tätig, neun Jahre davon als Leiterin Réception. Sie führt dort die MitarbeiterInnen und den Lehrling. Zuvor war sie schon rund drei Jahre in der Region Interlaken-Beatenberg mit ähnlichen Funktionen betraut. Frau Hofer ist am 17. Januar 1982 in Berlin geboren und seit September 2003 in der Schweiz tätig.
Annett Hofer
Frau Hofer wurde an der Delegiertenversammlung 2017 in Basel anstelle des langjährigen Mitgliedes Christian Fankhauser als Arbeitnehmer-Vertreterin gewählt. Sie war vor der Wahl schon für ein paar Monate im Gaststatus an der Arbeit im Stiftungsrat beteiligt und konnte so guten Einblick gewinnen. Sicher wird es noch eine gewisse Zeit brauchen, um die Komplexität einer Sammelstiftung, wie es die CoOpera Sammelstiftung ist, mit all ihren Facetten und Eigenheiten besser kennen zu lernen. Sich in einer bestehenden Gruppe zu integrieren, benötigt auch seine Zeit.
Ein grosses Anliegen des Stiftungsrates war es, erstens eine Verjüngung herbei zu führen und zweites den Frauenanteil zu steigern. Die Komplexität hat in der Zweiten Säule in den letzten Jahren stetig zugenommen und verlangt Interesse, Motivation und fortwährende Weiterbildung auf diesem Gebiet. Aus diesem Grunde möchten wir Frau Hofer für ihren Mut und die Zusage für diese Arbeit bestens danken.
Wir wünschen Frau Annett Hofer alles Gute, Initiative und viel Schwung für diese neue, verantwortungsvolle Aufgabe im Stiftungsrat der CoOpera Sammelstiftung PUK.
Versicherungsobligatorium 3 Monate
Wir stellen immer wieder fest, dass Arbeitgeber die Bestimmung „mit den drei Monaten“ verwechseln. Es gilt zu unterscheiden, ob mit den 3 Monaten die Probezeit oder eine befristete resp. temporäre Anstellung gemeint seien. Bei der temporären Anstellung ist wiederum zu differenzieren, ob die Anstellung über eine Temporärfirma geschieht.
Verschiedene Fälle: Probezeit, befristeter oder temporärer Vertrag
Die Versicherung in der beruflichen Vorsorge bei befristeten Arbeitsverträgen nach BVV2 Art. 1j und 1k sagt aus, dass grundsätzlich Personen mit einer befristeten Anstellung von höchstens drei Monaten nicht versichert werden müssen. Wird der Vertrag von Anfang an unbefristet vereinbart, ist die Person ab 1. Tag zu versichern, die Probezeit spielt keine Rolle. Wird ein befristeter Vertrag über die Dauer von drei Monaten hinaus verlängert, ist die Person ab dem Datum der Vereinbarung zu versichern, also ab Datum, an der das Gespräch für die Verlängerung statt findet. Der Versicherung in der beruflichen Vorsorge kann auch nicht ausgewichen werden, indem befristete Anstellungen aneinander gereiht werden. Art. 1k lit. b BVV2 klärt, dass wenn a) zusammengezählt befristete Anstellungen mehr als 3 Monate dauern und b) die Lücke zwischen den Anstellungen weniger als 3 Monate beträgt, die Personen ab Beginn des 4. Monats zu versichern sind.
Stellen Sie Personen über einen Stellenvermittler temporär an, sind diese in der Regel über die Temporärfirma versichert, was vertraglich unbedingt geregelt werden sollte. Art. 2 BVV2 sagt aus, dass angestellte Personen in diesem Fall als Angestellte der Temporärfirma gelten (Personalverleih).
Wir sind bei Fragen für Sie da.
Die Grundlage Ihrer Vorsorge und Reglementsänderungen per 2018
Das Vorsorgereglement ist das Herzstück zur Regelung Ihrer Vorsorge. Es wird laufend überprüft und wenn nötig per Anfang Jahr angepasst. Auch für 2018 drängten sich Anpassungen auf, einerseits infolge der neuen Bestimmungen im Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), welche unsere Gesetzgebung ebenfalls tanigert, andererseits weil unsere Verwaltungssoftware ab 2018 mehr Möglichkeiten bietet. Erfahren Sie im Bericht, wie Sie neu eine vorzeitige Pensionierung vorfinanzieren können – und vieles mehr. Die Arbeitgeber mögen den Newsletter bitte ihren Mitarbeitenden zukommen, danke.
Reglementsänderungen per 2018
Wir stellen Ihnen nachfolgend die wichtigsten Änderungen in Kürze vor. Das aktuelle Vorsorgereglement finden Sie auf unserer Website: https://coopera.ch/dokumente/unternehmen-institutionen/186-vorsorgereglement-der-coopera-sammelstiftung-puk-1-1-2017/file, das Reglement für 2018 wird Anfang Januar aufgeschaltet.
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unser Glossar, welches zahlreiche Begriffe der beruflichen Vorsorge erklärt: https://coopera.ch/wissenswert
Das frühest mögliche Pensionsalter liegt neu bei Frauen und Männern bei Alter 58. Entsprechend haben wir die Übergangsbestimmung (Kapitalbezug anstelle von Rente) für neu eintretende Selbständige (Solid’Art) angepasst.
In Art. 18 haben wir ergänzt, dass bei Firmen, deren Arbeitgeber mehr als die Hälfte der Beiträge finanzieren, die Mitarbeitenden freiwillig mehr Sparbeiträge leisten können.
In Art. 29 haben wir die vorzeitige Finanzierung einer Frühpension neu geregelt. Es ist möglich, die fehlende Summe bis zum ordentlichen Pensionsalter vorzufinanzieren. Wenn Sie sich bspw. mit 62 frühpensionieren möchten, aber die Rentenhöhe soll diese mit Alter 65 sein, können Sie diese Lücke vorfinanzieren. Es handelt sich um einen sogenannten Auskauf, welcher auch steuerlich abziehbar ist.
Zudem kann im Fall einer vorzeitigen Pensionierung neu eine Überbrückungsrente bezogen resp. vorfinanziert werden. Es ist möglich, die Überbrückungsrente, welche bis zum Bezug der AHV-Rente zur Auszahlung gelangt, entweder vorzufinanzieren oder aber vom vorhandenen Altersguthaben in Abzug zu bringen – was die Altersrente lebenslänglich schmälert.
Für die Lebenspartnerrente (Art. 36) sowie beim Todesfallkapital (Art. 39) werden für die Anspruchsberechtigung wieder der gemeinsame Wohnsitz in gemeinsamem Haushalt verlangt.
Art. 47 hat erneut kleine Anpassungen infolge des neuen Scheidungsrecht erfahren. Ebenfalls wurden die Überentschädigungsbedingungen wegen des neuen Unfallversicherungsgesetzes ergänzt.
Art. 55 regelt den Vorbezug für Wohneigentum, es wurde neu in die Verordnung aufgenommen, dass die Mindestrückzahlung eines Vorbezugs CHF 10‘000 betrage (vorher 20‘000); wir haben die Änderungen übernommen.
Zu guter Letzt: Die Verwaltungskosten betragen für alle Mitarbeitenden ab 2018 0.5 Prozent des versicherten Lohnes (vorher gestaffelter Satz 0.5 – 0.7 %), höchstens CHF 600.
Demgegenüber müssen wir für die Durchführung von Teilliquidationen den Aufwand berechnen, was ebenfalls im Kostenanhang verankert ist.
Warum es sich lohnt, im lokalen Biofachgeschäft einzukaufen
Vielleicht ist Ihr nächstgelegenes Biofachgeschäft* einer der innovativen und trendigen Läden, welche in letzter Zeit gegründet wurden. Einer mit vielen Waren im Offenverkauf, oder mit eigener Bar. Vielleicht ist es eher ein Geschäft der traditionellen Sorte, eins das seine Wurzeln tief in den lokalen Boden geschlagen hat und wo Sie das Personal mit Namen begrüsst.
Ob traditionell oder taufrisch, eins haben die Bioläden gemeinsam: sie verkaufen echte Werte: Wert-volle Produkte mit Geschichte, entweder von lokalen Bauern eingekauft oder mit Sorgfalt beim Bio-Lieferanten ausgesucht. Persönlich verkauft von Menschen, die sich Zeit für ein Gespräch oder eine persönliche Beratung nehmen. Biofachgeschäfte bereichern unser Leben: sie tragen zur Vielfalt der Schweiz bei und bringen Abwechslung in den Alltag.
Ein starker Partner für die individuellen Bioläden
Produkte, welche das Biofachgeschäft nicht beim lokalen Bio-Bauern einkaufen kann, beschafft er im Bio-Grosshandel. Die Bio Partner Schweiz AG ist der führende Schweizer Bio-Grosshändler. Das Unternehmen bedient den Biofachhandel, den übrigen Detailhandel sowie die Gastronomie in allen Sprachregionen der Schweiz – und verarbeitende Betriebe über die Landesgrenzen hinaus – mit hochwertigen Bio-Produkten bis hin zu Naturkosmetik.
Nebst ihrer Funktion als Grosshändler sieht sich Bio Partner aber auch in der Rolle eines echten Partners für die Bioläden. Nicht alle Bioläden profitieren vom Aufwind, welcher „Bio“ seit Jahren erlebt. Viel Um- und Absatz wandert zu den Grossverteilern und neuerdings sogar zu den Discountern ab. Da ist die Gefahr, dass lokale Bioläden zunehmend weniger Kunden haben. Bio Partner engagiert sich für die individuellen Biofachgeschäfte. Sie steht vor der Lancierung eines Unterstützungsprogramms, das unter anderem den Austausch zwischen den Läden fördern und Neugründern den Einstieg erleichtern soll. Kooperation statt Konkurrenz ist das Schlüsselwort.
* Wenn Sie sich nicht sicher sind wo sich Ihr nächstes Biofachgeschäft befindet, besuchen Sie gerne www.biopartner.ch/shopfinder/.
CoOpera und Bio Partner
Hauptaktionärin der Bio Partner Schweiz AG ist die Bio Development AG (www.bio-Development.net). CoOpera ist an beiden Gesellschaften beteiligt.
Biofachgeschäfte punkten mit regionalem Gemüse und Spezialitäten
Wann entdecken Sie wieder ein neues Produkt in Ihrem Bioladen?
Bilder: © Bio Partner Schweiz AG
Bio Development AG Seon
Die Beteiligung von rund 21% an der Bio Development AG Seon, die sich dank der CoOpera Beteiligungen AG im Biobereich etabliert hat, wurde, um die Zielsetzungen in ganz Europa zu realisieren auf die CoOpera Sammelstiftung PUK übertragen.
Die Bio Development AG mit Sitz in Seon ist eine Beteiligungsgesellschaft die sich zum Ziel gesetzt hat die Lösung von Nachfolgen bei Bio-Pionieren europaweit zu unterstützen. Bitte konsultieren Sie www.bio-development.net. Sie ist bereits Mehrheitsaktionärin des grössten Bio-Grosshändlers der Schweiz, der Bio Partner Schweiz AG, die vor etwas mehr als 10 Jahren aus dem Zusammenschluss von Vandadis, ViaVerde und Bio-Eichberg entstanden ist.
Nun ist sie auch an der drittgrössten Bioladenkette Deutschlands mit 40%, ab Januar 2018 mit 45% beteiligt: die Bio Company GmbH Berlin, die zurzeit 57 Filialen, vorwiegend in und um Berlin betreibt.

Ein weiterer bedeutender Schritt in Deutschland steht kurz vor Abschluss. Zudem wird die freundschaftliche Verbindung zu EcorNaturaSi mit über 300 Läden in Italien durch eine finanzielle Verbindung gestärkt.
Ebenso wird in Worb (nahe Bern/Schweiz) eine neue Milchmanufaktur für Produkte Demeter, Bio und Regio der Biomilk AG realisiert und im Sommer 2018 in Betrieb genommen. Bio Development AG und CoOpera Beteiligungen AG sind Kernaktionäre der Biomilk AG.
Ein nächster grosser Schritt wird ein Ladenverbund in der Schweiz mit etwa 70 - 100 Bioläden innert 5 Jahren sein, der auch in Zukunft aus unabhängigen Fachhändlern gebildet wird. Die Bio Partner Schweiz AG wird ein Servicepaket mit Standortberatung, Marketing, Ausbildung, Innenausbau und Marktauftritt entwickeln und den Fachhändlern ab 2018 anbieten.

CoOpera Sammelstiftung PUK: Warum Einkäufe gut sind | Zivilstandsänderungen
Persönliche Einkäufe auf das individuelles Konto bei der CoOpera Sammelstiftung PUK haben Saison, beachten Sie den Termin: 20.12.2017. Sie können Steuern sparen und verbessern Ihre Vorsorgeleistungen. Wir bitten Sie, Zivilstandsdaten bei Änderungen mitzuteilen.
Auf Ihrem letzten Vorsorgeausweis ersehen Sie die Einkaufsmöglichkeit. Sie können uns auch kontaktieren um diese Summe in Erfahrung zu bringen. Eine Einkaufsmöglichkeit besteht dann, wenn das Maximum des Altersguthabens noch nicht erreicht wurde. Dieses wiederum berechnet sich auf der Grundlage Ihrer Versicherungslösung bei uns, und geht von der Annahme aus, dass Sie während der gesamten Karriere ab Versicherungsbeginn bis zur Berechnung mit dem aktuellen Lohn sparten. Die Berechnung wird auf 31.12.2017 berechnet.
Mit einer Überweisung auf Ihr Konto senken sich Ihre Einnahmen bei der Steuererklärung, was sich direkt auf den steuerbaren Betrag auswirkt. Wir buchen den Einkauf voll ein. Das erhöht somit Ihre Vorsorgeleistungen und somit auch allfällige Hinterlassenenleistungen im Todesfall. Je nach Vorsorgeplan werden auch die Invalidenleistungen erhöht, nämlich dann, wenn sich die Leistung auf dem Altersguthaben stützt. Ausserdem erhalten Sie bei uns nach wie vor mehr Zins als dies auf einem üblichen Bankkonto der Fall wäre. Win-Win.
Bitte regeln Sie Ihren Einkauf so, dass die Zahlung spätestens am 20.12.2017 bei uns eingetroffen ist. Sollten Zahlungen eintreffen, welche nach dem 31.12.2017 bei einer Bank valutiert sind, können sie für das laufende Steuerjahr nicht berücksichtigt werden.
Zivilstandsänderungen:
Wir möchten Sie bitten , uns jeweils zeitnah zu melden, wenn Ihre Zivilstandsdaten ändern (Heirat, Scheidung). Besten Dank!
CoOpera Sammelstiftung PUK: Gibt es noch werterhaltende Wege für Pensionskassen Wege jenseits von Renditezwang und Idealismus?
Udo Herrmannstorfer plädiert in seinem Referat an der CoOpera DV2017 für eine vertiefte, aktive Mitgestaltung an den Anlageformen durch die Pensionskassen.
Udo Herrmannstorfer hat an der diesjährigen Delegiertenversammlung der CoOpera Sammelstiftung PUK ein Referat gehalten zum Thema: «Heutige Schwierigkeiten und Herausforderungen. Interessenkonflikte. Wie geht CoOpera damit um?»
Geld in Bewegung
Unsere Gesellschaft ist in einem grundsätzlichen Umbildeprozess begriffen, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Bisher fundamentale Grundhaltungen und Verhältnisse werden in Frage gestellt. Ungerechtigkeiten werden nicht mehr einfach hingenommen, sondern der Wunsch an deren Beseitigung mitzuwirken, wird zum Treiber weltweiter Unruhe. Dabei erweisen sich viele Vorschläge nur als Sanierungsmassnahmen für bestehende Verhältnisse und damit als temporäre Scheinverbesserungen. Andere Vorschläge dagegen sind entweder abstrakte Ideengebäude, die die dazu notwendigen Verhaltensänderungen der beteiligten Menschen ausser Acht lassen, oder bedienen nur die Interessenslage der Propagandisten.
Zwischen Leitbild und Wirklichkeit
Als Pensionskasse PUK haben wir uns verpflichtet, mit unserem Verhalten zur Entwicklung und Erhaltung nachhaltiger sozialer Arbeits- und Lebensverhältnisse beizutragen. Andererseits aber sind wir Teil der Gesellschaft und des Zeitgeschehens und nehmen an den gesellschaftlichen Umschichtungen teil. Daraus ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen nicht unerhebliche Spannungen zwischen unseren Leitideen und vielen gesellschaftlich bestimmenden Vorschriften, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir unser eigenes Anliegen zur Geltung bringen wollen. Wir dürfen dieser Entwicklung als Beteiligte nicht nur passiv zuschauen. Denn gerade die Alterssicherung beruht ja darauf, dass der soziale Organismus langfristig leistungsfähig und leistungswillig bleibt. Der Versorgungszuspruch (d.h. im Falle der 2.Säule das eingezahlte Kapital) soll auch nach Jahrzehnten noch werthaltig sein.
Ende der Sparzinsen?
Für die meisten Menschen und damit auch Sparer bedeutet Geld vor allem Tauschgeld (Kaufgeld), mit dem man Güter eintauschen, d.h. kaufen und verkaufen kann. Spargeld schafft einen zeitlichen Abstand zwischen Verkauf und Einkauf. Während dieser Zeit steht es für andere Zwecke leihweise zur Verfügung. Nach Ablauf der Frist wird es dem Sparer rückerstattet. Darüber hinaus erhält der Sparer für die Dauer der Sparzeit eine Verzinsung. Bisher zeigte die naive Erfahrung, dass Sparkapital sich verzinst, wenn man es zur Bank oder zu einer Kapitalsammelstelle wie der PUK bringt. Weil es so selbstverständlich zu sein scheint, enthalten alle Kapitalberechnungen innerhalb der Gesellschaft eine Zinszurechnung, ja sogar Zinseszinsen. Der dabei auftretende Zinseszinseffekt ist enorm: bei 3 % Verzinsung z.B. verdoppelt sich ein Kapital nach 24 Jahren, ohne dass der Sparer etwas dazu leisten musste. Das Sparkapital wird zurückgezahlt und ist deshalb nur verliehen; dieses Leihverhältnis wird in der Regel verbrieft, z.B. als Obligation. Für „risikoscheue“ oder „sicherheitsbewusste“ Kapitalhalter waren und sind es auch heute noch vor allem diese Obligationen, also verbriefte Darlehen, die dem Sparer einen Gläubigerstatus und eine Verzinsung sicherten. Durch diese Position als Gläubiger galten solche Schuldpapiere bis anhin als „mündelsicher“. Diese Darlehen haben aber eine Kehrseite. Die damit verbundene Zinszusage gilt über die ganze Laufzeit und sie gilt unabhängig davon, ob das als Kapital eingesetzte Spargeld tatsächlich eine Mehrleistung hervorgebracht hat. Zinsen müssen bezahlt werden. Bei einem Darlehen verbindet sich das Kapital nicht „auf Gedeih und Verderb“ sondern nur „auf Gedeih“ mit dem Investitionszweck; bei kritischen Lagen trennt es sich vom Unternehmen und macht nun seine Gläubigerposition gegen die ursprünglich geförderte Unternehmung geltend.
Wohin mit dem Geld?
Diese relativ bequeme Situation steht vor grossen Veränderungen und droht, alle bisherigen Rechnungen über den Haufen zu werfen. Denn der Zins für solche „halbherzigen“ Geldanlagen tendiert momentan gegen Null, an manchen Orten sogar zu einem Negativzins. Woher aber sollen Zinsen in Zukunft kommen? Mit einer solchen Entwicklung haben nur wenige gerechnet. Entsprechend geringe Erfahrungen liegen vor, wie mit diesem Phänomen umgegangen werden kann und welche Auswirkungen dies auf die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen haben wird. Und ein Ende dieser anlagelosen Geldschwemme ist gegenwärtig nicht abzusehen. Es zeigt sich nun ganz handfest, dass der Vorgang des Sparens keine Zinsen hervorbringt; vielmehr entstehen diese erst, wenn das Sparkapital investiv eingesetzt wird. Ein Überangebot an Geldkapital (allein die Pensionskassen verwalten ca. 700 Mrd. Franken) zeigt an, dass dieses Kapital keinen realwirtschaftlich sinnvollen Einsatzort mehr findet. Das nicht im Tauschprozess gebundene Geld sucht händeringend nach wertschöpfenden Anwendungen. Die Meinung, dass gespartes Geld Zinsen erzeugt, weicht langsam der Einsicht, dass der Geldwert letztlich nur von der Produktion realer Güter und Leistungen bestimmt wird. Es wird auch immer deutlicher, dass infolge des Mangels an Zinserträgen, die ursprünglich von den Sparern erwarteten Leistungen der Pensionskassen sich vermindern werden. Um dem entgegen zu wirken, hat die PUK ihre Anlagepolitik von Anfang an auf realwirtschaftliche Zwecke konzentriert und spekulative Geldpapiere gemieden.
Vom Sparzins zur Dividende
Anders sieht die Situation aber aus, wenn das Spargeldkapital sich ganz mit einer Unternehmung verbindet und zum Mitunternehmer in guten und in schlechten Zeiten wird. Dies geschieht zum grössten Teil durch Aktienkauf. (Ob das gegenwärtige Eigentumsrecht die geeignete Form der Verbindung ist, kann hier nicht weiter behandelt werden). Durch das Miteigentum verbindet sich das Kapital nun ganz mit dem Schicksal einer Unternehmung. Es wechselt von der Gläubigerseite auf die Seite des Unternehmers und übernimmt damit auch für den Erfolg der unternehmerischen Impulse Verantwortung. Kein Erfolg, keine Dividende. Damit entfallen auch Rückzahlung und Zinszahlung. An die Stelle der Zinsen tritt nun die Dividende als Anteil an dem bereits realisierten finanziellen Erfolg der Unternehmung. Diese Dividende soll gleichzeitig auch einen Ausgleich für das übernommene Verlustrisiko enthalten. Der Kapitalgeber entscheidet als Eigentümer über die Höhe der Dividende mit. Als Ertragsanteil wird sie nur ausbezahlt, wenn die Unternehmung mit ihren Leistungen einen Überschuss erwirtschaftet hat. Die Dividende als Ersatz für die Zinsen – und gleichzeitig auch im Gegensatz zu ihnen, ist erfolgsgebunden. Insofern sind Dividendenzahlungen aus unternehmerischer Sicht wesentlich sozialer als Zinszahlungen für Darlehen und wird deshalb vermehrt angestrebt. Der niedrige Zins für Darlehenskapital ist für die Unternehmungen ideal, einerseits senken sich dadurch die Kapitalkosten und andererseits verbessern sich die Erfolgsaussichten für Dividendenzahlungen. Deshalb wendet sich das Interesse der Geldanleger verstärkt solchen Anlageformen zu. „Dividenden sind der neue Zins“. Diese Verschiebung lässt sich bereits heute beobachten: Kapital, das sich ganz mit der Investition verbindet, wird auch jetzt noch mit Dividenden bedient und verzinst sich dadurch wesentlich höher als entsprechende Darlehen. Auch wenn die einen noch immer hoffen, dass sich die Zinsen für Obligationen wieder erholen, so müssen sich die Kapitalsammelstellen und Banken, besonders aber auch die Sparer sich stärker auf diese Art von symbiotischer Verbindung von Kapital und Unternehmung einstellen. Formen müssen z.B. entwickelt werden, wie das damit erhöhte Risiko solidarisiert werden kann (der Risikoausgleich der PUK ist ja solch ein Anfang) oder wie man mit schwankenden Erträgen die Zukunft „sichern“ kann.
Die Börse als Marktplatz spekulativer Werte
Dieser Schritt zur engeren Verbindung von Kapital und Unternehmung ist nicht neu, aber bisher sozial anrüchig ausgestaltet, nämlich als Aktie. Durch die Form der Aktie (hier stellvertretend für alle Papiere dieser Art) sind die o.a. Vorzüge in eine falsche, d.h. sozial problematische Richtung abgelenkt worden. Denn durch den Eigentumsstatus der Aktien sind Unternehmungen selbst käuflich geworden, nicht nur deren Produkte. Für den Handel mit Aktien wurde mit der Börse ein neuer eigener Markt geschaffen, für den andere Regeln gelten. Die Börse ist kein normaler Markt, das wäre sie nur, wenn der Handelswert auf der offengelegten tatsächlich vorhandenen Substanz und den zum Betrieb notwendigen Finanzmitteln, d.h. auf dem tatsächlich investierten Kapital beruhen würde. Das ist aber nur noch zum kleineren Teil der Fall und spielt an der Börse so gut wie keine Rolle mehr. Dafür ist eine neue Art der Bewertung in den Mittelpunkt gerückt, der Ertragswert, das ist im Kern das Gewinnpotenzial des Kapitals.
Das liegt daran, dass das Unternehmen nicht nur eine Ansammlung von einzelnen erworbenen Investitionsgütern ist, die zum Zeitpunkt der Übertragung nur bis zu einem bestimmten Umfang genutzt wurde. Sondern die als Unternehmen organisierte Einheit der Produktionsmittel ist gleichzeitig ein Produktionspotential. Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an, was die Produktionsmittel gekostet haben, sondern was man daraus macht. Das ist die spekulative Seite jeder Investition. Aber nun wurde rechtlich zugelassen, dass diese noch nicht erarbeiteten und daher noch spekulativen Erträge, die eigentlich der Zukunft gehören, bereits in der Gegenwart im Verkaufspreis aktiviert werden dürfen und dabei an die Rechtsverhältnisse der Vergangenheit, die Voreigentümer, transferiert werden. Im Ertragswert wird eine Zukunftserwartung in die Gegenwart projiziert als ob sie schon Wirklichkeit wäre. Dafür wird die Zukunft belastet, da deren Erträge bereits verbraucht wurden. Das Bärenfell wird verteilt, obwohl der Bär noch lebt. Als Folge ergeben sich dadurch entweder höhere Verschuldungen oder ein erhöhter Wachstumsdruck, um diesen „Zukunftsverlust“ zu kompensieren. Dies erzeugt neuen Kapitalbedarf und damit neue Kapitalanlagemöglichkeiten. Es entsteht ein sich selbst antreibender Prozess. Die Spekulation löst das Anlagekapital von der Realität ab und führt zur Form einer Wette auf Wahrscheinlichkeiten, so wie es z.B. bei Optionen der Fall ist. Damit fallen die letzten Realitätsgrenzen für Renditen. (Ebenfalls nicht behandelt wird hier die Entwicklung zu reinen Geldanlagepapieren, denen überhaupt keine Güterproduktion mehr zugrunde liegt, z.B. Derivate oder Optionen.)
Der in die Irre führende Performance-Vergleich
Es ist leicht einsehbar, dass diese Quelle scheinbar unbegrenzter Renditen alle diejenigen anzieht, die allein in der Kapitalvermehrung das Ziel ihrer Geldanlage sehen, ja sogar von Aufsichtsbehörden dazu angehalten werden, um die sozialpolitischen Ziele zu retten. Der Steigerung der Performance scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Aber kann man die Performance für das in spekulative Anlagen fliessende Sparkapital überhaupt vergleichen mit der Performance, die sich bisher für den Bereich der Güterproduktion im Zinsniveau der Obligationen ausgedrückt hat? Oder vertun wir in der CoOpera aus Ängstlichkeit die Chance zu einer einmaligen Wertsteigerung?
Hier soll nur auf einen grundsätzlichen Unterschied hingewiesen werden. Werden Güter und Leistungen hergestellt, dann fliessen der Gesellschaft reale Werte zu, die dem Geldwert Kaufkraft geben. Steigt aber der Börsenwert einer Aktie, dann entsteht ein neuer Geldanspruch, dem aber keine zusätzlichen Leistungen entsprechen. Da aber das durch den Börsenhandel gewaschene Geld (im Verkauf werden Scheinwerte in „echtes“ Geld umgewandelt) trotz fehlender Gegenleistung als Tauschgeld verwendet werden kann, so müssen die damit erworbenen Werte aus anderen Bereichen abgesaugt werden. Investitionen in solche Geldprozesse sind parasitär und richten auf die Dauer den sozialen Wirtsorganismus zu Grunde. Deshalb wurde der Begriff der „Blasen“ gebildet: eine glänzende Oberfläche aber substantiell nur mit Luft gefüllt.
Das Sparkapital am Scheideweg
Das Sparkapital steht also vor der Entscheidung, in welche Richtung es sich investiert. Verbindet es sich mit dem Leistungsstrom oder folgt es den spekulativen Verlockungen?
Das Dilemma wird im Zusammenhang mit der PUK am deutlichsten bei der Behandlung von Grund und Boden. Der Boden reicht in beide Kapitalbereiche hinein. Einerseits ist der Boden durch seine Nutzung für alle anderen Wertbildungen die Grundlage, ist also mit dem Realstrom eng verbunden. Wir versuchen, die Grundstücke so zu behandeln, dass sozial sinnvolle Nutzungen möglich sind. Dies schliesst das Ziel einer maximalen Renditeerzielung aus: je höher der Mietzins, umso schwerer wird das Leben. Andererseits wird Grund und Boden heute ebenfalls wie eine Ware gehandelt und ist damit mit voller Kraft in den Spekulationssog geraten. Hohe Bodenpreise müssen heute verzinst werden und belasten damit das Leben. Hier geht es darum, diese Werteexplosion im Bodenpreis zu dämpfen. Deshalb bewerten wir Grundstücke so niedrig wie möglich, um den Renditedruck zu senken. Für gesund würden wir es halten, wenn dem Boden sein Warencharakter genommen würde. Deshalb haben wir in bewusstem Zusammenhang damit die Bodenstiftung NEB gegründet, um Vermögenseigentum in Nutzungseigentum zu verwandeln und damit der Spekulation zu entziehen.
Die Zerstörungsdynamik, die der Handelbarkeit spekulativer Werte innewohnt, und der Bedarf an Neugestaltung der Finanzierung der Realwirtschaft zeigen, dass es mit der Wahlfreiheit der Anlageform nicht getan ist, sondern dass es der aktiven Mitgestaltung der Anlageformen durch die Kapitalanleger und damit auch durch unsere Pensionsstiftung bedarf, wenn die Entwicklung zum Besseren einsetzen soll.
Udo Herrmannstorfer
CoOpera Beteiligungen AG: Eine intelligente Geigenstütze dank der Kooperation von Dolfinos und CoOpera.
Geigenspielerinnen wie auch ihre Instrumente leiden darunter, dass im Bereich der Geigenstützen in den vergangenen 200 Jahre keine nennenswerte Fortschritte erzielt wurden und die Technologie entsprechend veraltet ist. Dolfinos hat mit ihrer Hightech Geigenstütze ein elegantes Produkt entwickelt, das die Musiker und ihre Instrumente endlich in Einklang bringt.
Der Swiss Startups Award Gewinner Dolfinos und die CoOpera Beteiligungen AG sind eine Partnerschaft eingegangen. Was uns verbindet, sind nicht nur ethische und nachhaltige wirtschaftliche Konzepte. Die CoOpera und die Dolfinos AG stellen das Wohl und die Sicherheit ihrer Kunden in den Mittelpunkt. Darüber hinaus verbinden uns das unermüdliche Streben nach kundennaher Innovation und das Engagement für Menschen, welche sich beruflich für künstlerisches Schaffen, Bildung und Soziales einsetzen.
Dolfinos stellt bahnbrechendes Equipment für Musiker her, um diese dabei zu unterstützen, Berufskrankheiten vorzubeugen und mehr Erfolgserlebnisse beim Lernen und Spielen zu haben.
Das erste Produkt wird eine Geigenstütze sein, welche die bisherigen Technologien (Kinnhalter und Schulterstütze) mit einer einzigen, alles umfassenden Lösung ersetzt. Diese beruht auf langjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit und wird in höchster Schweizer Qualität hergestellt.
Die Eigenschaften der patentierten Technologie fördern eine gesündere Haltung, erlauben eine mühelosere Motorik und lassen die Geige freier schwingen.
Um den bestmöglichen Kundennutzen zu erzielen, haben Geigenbauerinnen, Geigenprofessoren, Musikerinnen, Dermatologen, Physiologen, Ingenieurinnen, Akustiker und Designer an der Entwicklung mitgewirkt.
Die Sicherheit, der Wirkungsgrad und die Praktikabilität der Geigenstütze wurden in Studien, unter anderem am ETH Physiology Lab, erfolgreich getestet. Optimierte Hebelkräfte führen zu einfacheren Lagenwechseln und zu einer freieren Spieldynamik. Mit der Dolfinos Geigenstütze ist zur Kontrolle des Instrumentes weniger Kraftaufwand im Hals- und Nackenbereich notwendig. Dadurch werden Druckstellen am Körper nachweislich entlastet.
Dolfinos beginnt diesen Herbst mit dem Vorverkauf ihrer Geigenstütze.
Auf der Website von Dolfinos können Sie sich weiter über das Produkt und die Firma informieren und erfahren mehr über den bevorstehenden Vorverkauf: www.dolfinos.com/CoOpera
CoOpera Beteiligungen AG: Die CoOpera fördert die bauinnovative Firma Pneumatit AG
Das Startup Unternehmen Pneumatit AG entwickelt, produziert und vertreibt den bauinnnovativen Betonzusatzmittel Pneumatit ®. Mit Pneumatit wirkt der Beton wohltuender auf Mensch und Tier.
Das von der Pneumatit AG in Rheinau entwickelte, produzierte und vertriebene Betonzusatzmittel Pneumatit® verankert eine feine biologische Aktivität dauerhaft im Baustoff. Dieser verliert seine beeinträchtigenden Wirkungen auf Physiologie und Empfinden – und wirkt sich messbar unterstützend aus. Die CoOpera Beteiligungen AG fördert das Startup-Unternehmen in Rheinau mit einem Aktienpaket und einem Darlehen.
Dass der geniale Baustoff Beton als unbehaglich, beeinträchtigend und bis pathogen erlebt wird, hat Gründe. Im Projekt Fintan (Rheinau) mit dem grössten biodynamischen Landwirtschaftsbetrieb der Schweiz setzte Markus Sieber mit Forscher José Martinez für Neubauten (Laufstall, Wohnhäuser 2006-10) ein zunächst aberwitziges Forschungsprojekt in Gang. Man wollte einen Beton, der für Mensch und Tier freundlicher und gesünder sei als auch Raum für individuelle Entfaltung und Entwicklung biete. Motto: Beton hat den nächsten Schritt verdient.
Biodynamischer Beton ist möglich geworden.
Belebung des Mineralisch-Toten: Viele Menschen erleben die Pneumatit-Wirkungen bewusst und umschreiben sie als Weite, Wärme, Wohlbefinden: „Hier darf man sich selber sein.“ (St. Grubenmann, Heimarzt Sunnegg Walkringen). Sämtliche vorgenommenen Untersuchungen bestätigen dies, darunter ein grosser Vergleichstest auf der Basis der Herzraten-Variabilität sowie Psychometrie. Kristallisationsbilder machen das neue Leben sichtbar und Untersuchungen auf überphysischer Ebene stellen fest, dass insbesondere auch die höheren seelisch-geistigen Funktionen des Menschen unterstützt werden. Chemisch und physikalisch belässt Pneumatit den Baustoff völlig unverändert.

Ursprünglich nur für den Eigenbedarf entwickelt, überraschte Pneumatit durch eine langsam steigende Nachfrage von aussen. Erst seit 2016 wird aktives Marketing betrieben, als bereits 13‘000 m3 Beton im In- und Ausland beschickt worden waren. Ein professioneller Betrieb hatte sich (fast) von selbst entwickelt, er wurde 2014 als GmbH konstituiert und 2017 in eine AG umgewandelt, mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung. Pneumatit ist CE-zertifiziert und europaweit zugelassen, die zusätzliche Zulassung nach SIA-Norm SN EN 206 wird auf November erwartet.
Auch praktisch hat sich die CoOpera für biodynamischen Beton entschieden: im aktuellen Neubauprojekt Biomilk Worb und für nächste Bauten.
CoOpera Sammelstiftung PUK: Altersvorsorge 2020 Abstimmungshilfe
Am 24. September 2017 findet die Volksabstimmung über die Altersvorsorge 2020 statt. Bei Annahme tritt die Reform am 1. Januar 2018 in Kraft, die Senkung des Umwandlungssatzes sowie die Kompensationsmassnahmen dazu ein Jahr später. Wie jede Vorlage bringt auch diese Vor- und Nachteile.
Wir möchten unseren angeschlossenen Arbeitgebern und Versicherten eine neutrale Information zukommen lassen.
Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Massnahmen:
- Erhöhung Referenzalter Frauen auf 65 Jahre
- Flexibler Rentenbezug in der AHV
- Zusatzfinanzierung durch Mehrwertsteuer (separater Bundesbeschluss)
- Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes
- Massnahmen im BVG zum Erhalt des Rentenniveaus
- Ausgleichsmassnahmen in der AHV
- Verbesserungen der Transparenz im Geschäft der beruflichen Vorsorge der Lebensversicherer
- Inkrafttreten in zwei Schritten
Die demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich, daher muss auch das Rentensystem angepasst werden. Nur so sind die Stabilität des Vorsorgesystems und die Sicherheit der Renten garantiert. Das sollte auch im Interesse der Versicherten der CoOpera Sammelstiftung PUK liegen.
Wie auch immer diese Abstimmung ausgehen wird, eines ist klar: Die Menschen werden immer häufiger 80, 90 oder sogar 100 Jahre alt. Damit verschiebt sich das gesellschaftliche und ökonomische Koordinatensystem grundlegend.
Etwas verwirrend mag sein, dass die Reform die AHV und die berufliche Vorsorge tangiert.
Bei der AHV würde die flexible Pensionierung eingeführt, und zwar für Alter 62 bis 70. Die AHV-Beiträge würden für Arbeitgeber und Arbeitnehmer um je 0.15 %, die Mehrwertsteuer um 0.3 % erhöht.
Für Neurentner der AHV ist eine Erhöhung von 70 Franken monatlich vorgesehen, die maximale Ehepartnerrente würde um 225 Franken monatlich erhöht.
Die Angleichung des Referenzrentenalters für Frauen und Männer auf 65 Jahre und die Erhöhung der Mehrwertsteuer wirken sich positiv auf die AHV aus.
Das Referenzalter 65 für Frauen würde schrittweise eingeführt:
|
Jahr |
Jahrgang |
Referenzalter resp. Pensionierungsalter |
|
2018 |
1954 |
64 Jahre und 3 Monate |
|
2019 |
1955 |
64 Jahre und 6 Monate |
|
2020 |
1956 |
64 Jahre und 9 Monate |
|
2021 |
1957 |
65 Jahre |
Die AHV führt somit eine flexiblere Lösung für die Pensionierung zwischen 62 und 70 Jahre ein. Die berufliche Vorsorge würde ebenfalls an das frühestmögliche Pensionsalter von 62 gebunden, es sei denn, im Vorsorgereglement ist das Referenzalter nicht höher als 65 Jahre. Dann kann die Pensionskasse ihre Versicherten frühestens mit 60 Jahren pensionieren. Das Referenzalter im BVG würde sich weiterhin an der AHV orientieren, also ebenfalls für beide Geschlechter auf 65 Jahre lauten.
Die Senkung des Umwandlungssatzes von heute 6.8 auf 6 Prozent reduziert die systemfremde Umverteilung in der beruflichen Vorsorge und ist ein wichtiger Schritt in Richtung Generationengerechtigkeit. Der Umwandlungssatz ist eine versicherungsmathematische Gleichung und wird am statistisch zu erwartenden Alter gemessen. Hervorzuheben ist, dass es sich um den gesetzlichen Umwandlungssatz handelt, und dass ein Grossteil der Versicherten zusätzlich überobligatorisch versichert ist, wo der gesetzliche Umwandlungssatz im Anrechnungsprinzip angewendet wird. Das heisst: Über die gesamte Versicherung muss mindestens das Minimum eingehalten werden.
Er würde unter Berücksichtigung einer Übergangsgeneration von 20 Jahren gesenkt (Zuschüsse durch Sicherheitsfonds für Versicherte von 45 Jahren und älter).
Mit einer Senkung des Umwandlungssatzes geht eine Senkung der Altersrenten einher (Berechnung der Altersrente im Beitragsprimat: Vorhandenes Altersguthaben im Pensionierungszeitpunkt mal Umwandlungssatz). Um den daraus zwangsläufig tieferen Renten entgegenzuwirken, ist ein Zusatzsparen vorgesehen. Gemäss BVG werden aktuell gestaffelt nach Alter 25 – 34 Jahre 7 %, 35 – 44 Jahre 10 %, 45 – 54 Jahre 15 % und 55 bis 64/65 Jahre 18 % Sparbeiträge des versicherten Lohnes gutgeschrieben. Die Reform sieht eine erhöhte Staffelung von 7/11/16/18 % vor.
Zusätzlich soll die Senkung des Umwandlungssatzes mit der Senkung des Koordinationsabzugs kompensiert werden. Dadurch erhöht sich der versicherte Lohn und somit die Spargutschriften. Der aktuelle Abzug von CHF 24‘675 (oder 7/8 der maximalen AHV-Rente) sollen neu 40 % des Lohnes in Abzug gebracht werden (minimal 14‘100, maximal 21‘150).
CoOpera Sammelstiftung: Freizügigkeitsgelder einbringen?
Freizügigkeitsgelder folgen dem Versicherten. So will es das Gesetz. Aber was heisst das für die versicherten Personen? Ist es überhaupt vorgeschrieben und empfehlenswert, diese Gelder in die Kasse zu bringen? Was passiert sonst mit dem Geld? Sicher ist, dass mit den angesparten Geldern in der Pensionskasse die Leistungen verbessert werden – denn: Ohne Finanzierung keine Leistung. Zudem verzinsen Freizügigkeitsstiftungen die Gelder tiefer als dies Pensionskassen tun.
Eine Altersrente der Pensionskasse wird über die Jahre aufgebaut, während denen die Sparbeiträge einbezahlt werden. In der Regel bezahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte, oder aber der Vorsorgeplan sieht einen höheren Arbeitgeberbeitrag vor. Die Beiträge werden in ein individuelles Konto gebucht und verzinst und ergeben, multipliziert mit dem Umwandlungssatz, die Altersrente. Dieses System ist – nebenbei erwähnt - nicht nur im Beitragsprimat der Fall sondern etwas abgeändert auch im Leistungsprimat. Es stehen immer Sparbeiträge den Altersleistungen gegenüber. Unsere Kasse allerdings rechnet für die Altersleistungen immer im Beitragsprimat wie oben beschrieben.
Es erscheint deshalb einfach nachzuvollziehen, dass Freizügigkeitsleistungen, welche auf einer Freizügigkeitsstiftung liegen, der Pensionskasse für die Altersleistungen fehlen. Die Vorsorgeeinrichtungen, bei der ein Versicherter austritt resp. die Versicherten, sind von Gesetzes wegen verpflichtet, die Gelder in die neue Pensionskasse zu überführen. Die Rede ist davon, dass das Geld dem Versicherten folgt. Leider geht das nicht automatisch, sondern man muss sich darum kümmern. Bedenken Sie zusätzlich, dass der tiefere Zins in der Freizügigkeitsstiftung über die Jahre nach wie vor einen nicht zu unterschätzenden Negativeffekt auf das Kapital ausübt. Optimal ist es deshalb, wenn die Freizügigkeitsleistung stets kurz nach Eintritt in eine neue Pensionskasse übertragen wird. Sollten Sie unsicher sein, ob noch Gelder vorhanden sind, können Sie bei der Zentralstelle 2. Säule eine Anfrage starten (www.verbindungsstelle.ch, Formular Anfrage).
Wir empfehlen Ihnen aus den erwähnten Gründen, Ihre Freizügigkeitsleistungen einzubringen, falls Sie noch solche auf einem Konto haben. Rufen Sie uns bei Fragen an, wir beantworten sie gerne. Wissenswertes zur Altersvorsorge
CoOpera Sammelstiftung PUK - Sinnvolle Beweidung mit Win-Win-Situation
CoOpera Sammelstiftung PUK - Neuigkeiten der Sammelstiftung
Bei der Sammelstiftung laufen diverse Projekte für 2018 parallel: Wie angekündigt berechnen wir die Risikoprämien neu; für die Mehrheit unserer angeschlossenen Arbeitgeber bedeutet das eine Senkung. Zusätzlich lassen wir die Staffelung bei den Verwaltungskosten fallen, was sich ebenfalls für die meisten in einer Senkung bemerkbar macht. Steigen werden die Verwaltungskosten für keinen Arbeitgeber – obwohl wir mit der neuen Software für alle bedeutende Verbesserungen einführen können. Wir hoffen, dass per Anfang nächsten Jahres auch der Onlinezugriff für sämtliche Versicherten auf die wichtigsten Daten umgesetzt sein wird.
Zusätzlich prüfen wir die Anschlussvereinbarungen auf ihre Aktualität. Einigen Arbeitgebern werden wir im Sommer neu ausgefertigte Unterlagen zustellen.
Über alle Anpassungen werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Die Fragebogen, welche wir sämtlichen Versicherten zustellten, haben wir ausgewertet. Der Rücklauf betrug rund 12 Prozent. Erfreut haben wir festgestellt, dass die Teilnehmenden fast alle unsere Anlagephilosophie kennen. Und diese rühmen, weil sie ihren Werten entspricht. Potenzial orten wir bei der Publikation von unseren Informationen in französischer Sprache, diese ist manchmal unvollständig. Jene Personen, welche von uns mündlich in Französisch nicht ganz exakt beraten wurden, bitten wir um Nachsicht. Viele Französischsprechende, welche strichen jedoch heraus, es zu schätzen, dass sie in ihrer Sprache Auskunft erhielten.
Etwas Verbesserungspotenzial orten wir bei der Formulartechnik auf unserer Homepage. Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam machen, dass der Browser teilweise ein Direktversenden der Formulare verunmöglicht. Die meisten Kommentare äussern sich demgegenüber mit „übersichtlich, modern, ansprechend“. Erstaunlich ist, dass die Mehrzahl der Befragten die Homepage gar nie besucht. Ob das digitale Zeitalter an Reiz verliert? Oder, mit den Worten einer befragten Person: „Müssen alle ihr Homepageli haben?“
Was uns herzlich freut, ist die Beantwortung zur Zufriedenheit der Dienstleistung insgesamt: Wir erhielten praktisch alles durchwegs positive Kommentare. Den wenigen negativen werden wir nachgehen und Verbesserungen suchen.
Ihnen allen, ob Sie teilgenommen haben oder nicht: Vielen Dank für Ihre Treue zu unserer Sammelstiftung. Ihre Kommentare sind uns Motivation, unsere Tätigkeit stets zu optimieren.
CoOpera Hypotheken: NEU festverzinsliche Hypotheken und «Best-Age» Hypotheken
Die CoOpera Sammelstiftung PUK finanziert Wohneigentum, hilft bei Gewerbebauten und ist offen für neue Nutzungsformen. Paare, Singles und Familien, Erwerbstätige und Pensionierte, Genossenschaften, Firmen und Institutionen. NEU: Die CoOpera Sammelstiftung PUK finanziert auch grössere Sanierungen von Liegenschaften, die Pensionierten gehören «CoOpera Best-Age-Hypotheken».
In ihrer Kalkulation und ihren Vergabekriterien ist die CoOpera Sammelstiftung klar und transparent.
Variable Hypotheken
Die CoOpera Sammelstiftung PUK gewährt Hypotheken mit variablen Zinssätzen und offener Laufzeit.
Die Zinssätze orientieren sich am jeweils geltenden BVG-Mindestzinssatz plus einer Zinsmarge von 0.75 – 3.5%, da die CoOpera Sammelstiftung PUK als Pensionskasse diese Zinssätze erwirtschaften muss.
NEU: Festverzinsliche Hypotheken
Anfangs 2017 hat sich der Stiftungsrat der CoOpera Sammelstiftung PUK dazu entschieden auf maximal 3 Jahre festverzinsliche Hypotheken zu gewähren. Der Zinssatz orientiert sich an dem vom Bundesrat festgelegten BVG-Mindestzinssatz plus Zinsmarge.
Annuitäten-Hypoheken
Hypotheken mit einem monatlichen fixen Betrag, der höher sein muss als die reine Verzinsung der Hypothek. Die Differenz wird laufend als Amortisation verwendet.
Beispiel:
1. Hypothek 300.000, Zinssatz 2%, keine Amortisationspflicht, 2. Hypothek 150.000, Zinssatz 2,5%, vereinbarte Amortisation 4%, die monatliche Zahlung (Annuität in Monatsraten) beträgt CHF 1.419,50 und entspricht etwa einer Monatsmiete für eine 3.5-Zi-Wohnung in einer ländlichen Gegend.
NEU: CoOpera «Best-Age» Hypotheken
Wer im Ruhestand ist und eine grössere Sanierung an seiner Liegenschaft ausführen will, hat in der Regel Mühe eine neue Hypothek oder eine Aufstockung der bestehenden Hypothek zu erhalten. Die CoOpera Sammelstiftung PUK ermöglicht das unter gewissen Voraussetzungen. Fragen Sie nach!
Im Bereich der ersten Hypothek können wir Reverse-Hypotheken anbieten, d.h. die anfallenden Hypothekarzinsen werden laufend aufs Kapital geschlagen, so dass der Hypothekarnehmer keine Zahlungen vornehmen muss.
Im Folgenden informieren wir Sie gerne über unsere Zinssätze und Amortisation:
Die folgenden Bedingungen gelten für grundpfandgesicherte Darlehen an Schweizer Schuldner mit Liegenschaft in der Schweiz (Hypotheken in CHF).
Zinsbasis:
Die CoOpera Sammelstiftung PUK orientiert sich bei der Festlegung der Zinssätze in erster Linie an den vom Bundesrat festgelegten Mindestzinssatz für Pensionskassen (BVG). Die aktuellen Zinssätze (1.1.2017) basieren auf dem BVG-Mindestzinssatz von 1,00% plus Zinsmarge. Drunter kann die CoOpera Sammelstiftung PUK nicht gehen, weil die Zinssätze als Pensionskasse erwirtschaftet werden müssen.
Zinsmarge:
Für die Risikodeckung, die Anlageverwaltung und für die Bildung von Wertschwankungsreserven wird ein Zuschlag erhoben (Zinsmarge). Die aktuelle Zinsmarge beträgt je nach Darlehenskategorie 0.75 – 3.5% zuzüglich Sicherungsfonds.
Merkblatt für CoOpera Hypotheken
Sind Sie interessiert?
Wenn Sie von der CoOpera Sammelstiftung PUK ein Hypothekardarlehen möchten, kontaktieren Sie uns. Herrn Markus Wegmüller gibt Ihnen gerne Auskunft, E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Tel. 031 924 32 33
CoOpera Sammelstitung PUK: Venture Capital Schweiz
Am 2. Mai 2017 hat das Bundesamt für Sozialversicherung BSV zusammen mit den Pensionskas-senverband ASIP, bei dem wir auch Mitglied sind, zu einem Informationsanlass zum Thema Schaf-fung eines Fonds „Venture Capital Schweiz“ eingeladen. Angeregt wurden sie offenbar einerseits durch die Motion Graber vom 12.12.2013 und andererseits durch die missliche Ertragslage der Schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen.
In der Präsentation des BSV wurde die Idee wie folgt umschrieben:
Investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio von zukunftsträchtigen Jungunternehmen zur Förderung des Standortes Schweiz bei gleichzeitiger Erzielung einer ansprechenden Rendite von 8-10% (IRR).
Diese Idee soll wie folgt umgesetzt werden:
Ansprechende und langfristige stabile Renditen dank:
- Professionelles Fondsmanagement auf Dachfonds- wie Zielfondsebene wird durch eine FINMA regulierte Struktur sichergestellt.
- Breite Diversifikation senkt das Ausfallrisiko und bringt Sicherheit.
Im Vergleich zu den übrigen Industrienationen weltweit steht die Schweiz mit Venture Capital, also mit der Finanzierung von Start Up’s (Firmenneugründungen mit neuartigen Produkten oder Geschäftsmodellen), ziemlich schlecht da und von den effektiven Finanzierungen von Start Up’s in der Schweiz stammen nur 40% der Kapitalien aus der Schweiz selber. Da ist ganz sicher Handlungsbedarf.
Die CoOpera Sammelstiftung PUK hat diesen Handlungsbedarf bereits bei ihrer Gründung festgestellt und ihr Anlagemotto „Geld zurück in die Wirtschaft“ ist bereits ein Teil der Lösung. Um konkret auch Start Up’s und Unternehmenserweiterungen mit dem nötigen Eigenkapital zu versehen, hat sie 1991 die CoOpera Beteiligungen AG gegründet (siehe www.coopera.ch/beteiligungen). Sie ist heute mit rund 30 Mio. in KMU’s investiert und arbeitet seit Jahren erfolgreich. Ihr Ziel ist nicht eine Renditeoptimierung, sondern ethisch, sozial und ökologisch sinnvolle Wirtschaft zu ermöglichen und dabei eine angemessene Verzinsung des Kapitals zu erreichen. Die in der Idee des BSV stipulierte Renditeerwartung von 8-10% p.a. kann in diesem Bereich nimmer erwirtschaftet werden. www.asip.ch
Neues Wohnbauprojekt in Itingen BL
In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof der Baselbieter Gemeinde Itingen wird eine Wohnüberbauung mit hohem Ausbaustandard bei moderaten Mieten, sowie ökologische Baustoffe und Technik bei niedrigen Baukosten entstehen. Die Realisierung der Überbauung mit 46 Wohneinheiten ist in den Jahren 2018/2019 geplant.
In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof der Baselbieter Gemeinde Itingen wird eine Wohnüberbauung mit hohem Ausbaustandard bei moderaten Mieten, sowie ökologische Baustoffe und Technik bei niedrigen Baukosten entstehen. Die Realisierung der Überbauung mit 46 Wohneinheiten ist in den Jahren 2018/2019 geplant.
Im Oktober 2015 hat die CoOpera Sammelstiftung PUK Baufelder in Itingen BL käuflich erworben und im Sinne der Verkäufer-Familie Imhof gesamtheitlich und mit den Anrainer koordiniert auf Basis des Quartierplanes das bauprojekt ausgearbeitet.
Das vorliegende Projekt nimmt für sich in Anspruch, die Leitlinien der CoOpera Sammelstiftung PUK und den Anforderungen des Ortes gerecht zu werden. Das bedeutet innerhalb der Quartierplanvorgaben einen attraktiven Wohnungsbaumix, einen hohen Ausbaustandard bei moderaten Mieten, einer lebendigen Architektur, sowie ökologische Baustoffe und Technik bei niedrigen Baukosten zu erreichen oder anzuwenden. Geplant ist ein ausgewogener und auf die Gegend angepasster Mix von 46 Wohneinheiten in dem vom Studio bis zur Maisonette-Wohnung alles zu finden ist.
Der Realisierung ist in den Jahren 2018/19 geplant.
CoOpera Beteiligungen AG: Eine Mehrwegbox zur Reduktion der Abfallberge
Die Berner Firma reCIRCLE GmbH produziert Boxen, die den Take-Away-Verpflegungsabfall reduzieren. Das Angebot entspricht einem wachsenden Bedürfnis, die Firma expandiert und eine Finanzierung durch CoOpera Beteiligungen AG befindet sich in Vorbereitung. Die Firma wurde jüngst in der Kategorie Firmen mit dem Schweizerischen Umweltpreis 2017 ausgezeichnet
reCIRCLE ist die neue „ready to use“ Methode um einfach im Alltag Abfall zu vermeiden: Als Firma oder Einzelperson spart man mit jeder Nutzung auch wertvolle Ressourcen. Mit jeder Mehrwegschale können mindestens 100 Einwegschalen vermieden werden. Dies entspricht einer Einsparung von rund 8 Liter Erdöl oder 18 Kilogramm CO2-Ausstoss.
Die Mehrwegbehälter „Rebox“ sind seit drei Jahren im Umlauf (anfangs unter dem Namen „Grüne Tatze“), hinzu kam die Mehrwegtasse „Recup“. Bereits als grüne Tatze erhielt die Firma Recircle den Anerkennungspreis der Stadt Bern „Goldenen Besen“ für vorbildliches Engagement für eine saubere Stadt. Das Bundesamt für Umwelt unterstützte ursprünglich das Pilotprojekt, welches mit 12 Take-aways begann. Heute wird das reCIRCLE-Geschirr bereits von rund 70 Restaurants für 10 Franken Depot ausgegeben. Die Box kann nach dem Essen gegen ein sauberes Geschirr ausgetauscht werden, der Benutzende nimmt das Geld zurück oder spült es selbst und lässt es wieder auffüllen. Die neuen Behälter werden in Einsiedeln produziert, sind dicht, mikrowellentauglich, durch das hochwertige Material sehr langhaltend und hygienisch.
Auch Firmenchefs unterstützen die Bemühungen, den Abfall zu reduzieren. Beispielsweise verschenkte die BLS 400 Reboxen an ihr Personal, welches diese im Alltag rege benützt.
Die CoOpera ist überzeugt, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeht und freuen uns darüber, damit eine weitere nachhaltige Unternehmensidee mitfinanzieren zu können. Der umtriebigen reCIRCLE-Chefin Jeannette Morath werden auch in Zukunft die Ideen nicht so rasch ausgehen, auch wenn gemäss ihrer Aussage die Entwicklung des Unternehmens langsamer vonstatten geht, als sie erwartete.
CoOpera Beteiligungen AG: Biomilk AG legt den Grundstein für neuen Produktionsstandort
An zentraler Lage in Worb wurde am 31. Mai der Grundstein für den neuen Produktionsbetrieb der Biomilk AG Münsingen gelegt. Ab kommendem Frühjahr werden dort aus regionaler Milch, ein grosser Teil davon in Demeter- und Bio-Qualität, nach handwerklichen Prinzipien und schonender Philosophie hochwertige Milchprodukte für den regionalen und nationalen Markt hergestellt. Damit werden Produktion und Sortiment der Biomilk AG und der Chäsi Worb zusammengefasst.
Durch den Neubau erweitern der bisher in Münsingen tätige Demeter- und Bio-Pionier Biomilk AG und das in Worb ansässige Traditionsunternehmen Chäsi Worb ihre Produktionskapazität entscheidend. Mit dem Zusammenschluss festigt das Unternehmen seine Position als wichtiger regionaler und bedeutender Bio-Milchverarbeiter in der Schweiz in besonders nachhaltigen und naturnahen Prozessen.
Die CoOpera Immobilien AG ist Bauherrin dieses neuen Produktionsbetriebs und die CoOpera Beteiligungen AG ist Kernaktionärin der Biomilk AG. Wir investieren in den neuen Produktionsstandort in Worb insgesamt gut 8 Millionen Franken für das Gebäude und über 2 Millionen Franken für die Produktionsanlagen. „Wir bauen eine Milchmanufaktur, die durch die besonders schonende, regionale und naturnahe Herstellung von Milchprodukten ein wichtiger Teil einer verantwortungsvollen Milchwirtschaft vom Bauernhof bis zum Konsumenten ist. Das tun wir, weil wir überzeugt sind, dass eine nachhaltige Milchwirtschaft allen etwas bringt – den Bauern, dem Verarbeiter, den Konsumenten“, erklärt Markus Lüthi, Verwaltungsratspräsident von Biomilk AG und Delegierter des Verwaltungsrats der CoOpera Beteiligungen AG.
Wir finden, eine solche – schon fast bodenständige – Investition ist für unsere Versicherten besser nachvollziehbar als eine Berg- und Talfahrt ihrer Gelder an der Aktienbörse. www.biomilk.ch / www.chaesiworb.ch

CoOpera Sammelstiftung PUK: „Haus der Gegenwart“ Lenzburg: Der Grundstein für das neue Haus wurde gelegt
Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum «Haus der Gegenwart» (Arbeitstitel) ist erreicht: Am 5. Mai fand die offizielle Grundsteinlegung statt, mit Reden, Bratwurst, Bier und Klarinettenklängen. Im Beisein von vielen engagierten Beteiligten wurde eine Metallkiste, die sogenannte «Zeitkapsel», mit wichtigen Dokumenten im Fundament der künftigen Ausstellungsstätte feierlich versenkt.
Als nächster entscheidender Schritt folgt nun die Namensfindung des neuen Hauses.
Das Stapferhaus Lenzburg ist mit Ausstellungen wie „Entscheiden“ und „Geld“ seit Jahren sehr erfolgreich. Die aktuelle Produktion „Heimat – eine Grenzerfahrung“ zog während der ersten sieben Wochen über 12‘000 Besucher an. Die interaktive Ausstellung im Lenzburger Zeughausareal ermöglicht zusätzlich den Besuch auf einem Riesenrad – und den Blick über die Stadt.
Gleichzeitig plant das Stapferhaus die nächste Ausstellung. Diese soll 2018 im „Haus der Gegenwart“ gegenüber dem Bahnhof Lenzburg eröffnet werden. Das rund 24 Millionen Franken teure Kulturhaus wird das neue zu Hause des Stapferhauses, dessen Büros heute auf dem Schloss Lenzburg untergebracht sind.
Die Bauarbeiten laufen und Anfang Mai fand die Grundsteinlegung statt. „Wir sind stolz, dass das Stapferhaus in Lenzburg bleibt, und dies an so prominenter Lage beim Bahnhof“, sagte Stadtamman Daniel Mosimann, und legte die Baubewilligung in eine Metallkiste. Die „Zeitkapsel“ wurde mit weiteren Dokumenten wie Baurechtsvertrag, Zeitungen und einem Modell des zweistöckigen Gebäudes gefüttert – und unter Applaus feierlich „mit den besten Wünschen für viele kreative Ideen“ – so die Stiftungsratspräsidentin und FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger - versenkt.
Die CoOpera Sammelstiftung PUK als Grundeigentümerin des „Hauses zur Gegenwart“ bestätigt mit diesem Engagement, dass sie Versichertengelder sinnstiftend investiert. Dem „Haus der Gegenwart“ die besten Wünsche für weitere glanzvolle Ausstellungen. www.stapferhaus.ch


CoOpera Galgenfeldweg 16 | 3006 Bern | Telefon 031 922 28 22 | info@coopera.ch | Datenschutzerklärung